KI im Private Markets: Die Gefahr eines sich selbst kannibalisierenden KI
Künstliche Intelligenz (KI) ist längst im Private Markets Sektor angekommen. Doch je größer die Abhängigkeit von KI-Systemen, desto größer auch die Risiken. Eine zentrale, oft übersehene Gefahr ist die „Selbst-Kannibalisierung“: Wenn KI zunehmend auf KI-generierten Daten trainiert wird, entstehen Feedback-Schleifen, die Datenqualität, Vielfalt und den Realitätsbezug erodieren lassen.
Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Beratung.
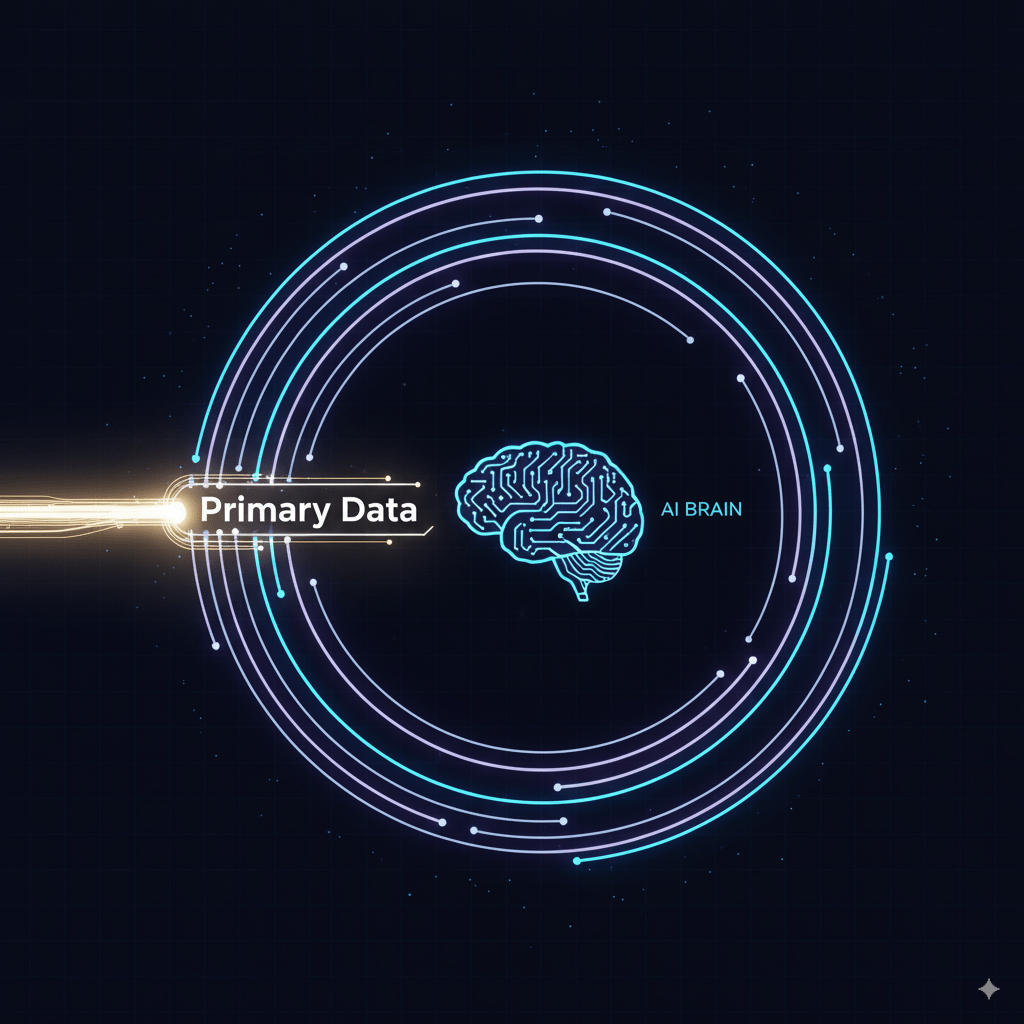
Die Gefahr der Selbst-Kannibalisierung: Wenn KI von KI lernt
Unter Selbst-Kannibalisierung versteht man das Phänomen, dass KI-Modelle nicht mehr auf originären, menschlich erzeugten Primärdaten, sondern auf von KI selbst produzierten, synthetischen Daten trainiert werden. Ein einfaches Beispiel sind Reporting-Vorlagen: Wenn eine KI standardisierte Muster immer wieder reproduziert, sinkt mit der Zeit die inhaltliche Vielfalt. Statt maßgeschneiderter Auswertungen entstehen austauschbare Reports. Das Risiko: Daten und Analysen „glätten“ die Realität, statt sie präzise abzubilden.
Warum Private Markets besonders anfällig sind
Gerade im illiquiden Private Markets Sektor, wo Daten ohnehin spärlicher und schwerer zugänglich sind als in Public Markets, kann dies gravierende Folgen haben:
- Investoren-Reporting: KI-Tools könnten Berichte angleichen und dabei die individuellen Anforderungen einzelner Limited Partners (LPs) vernachlässigen.
- NAV-Berechnung: Wenn extreme Werte oder Ausreißer von Modellen als Anomalien geglättet werden, können wichtige Risikosignale verschwinden.
- Due Diligence: KI könnte verstärkt auf von KI verfasste Analystenberichte zurückgreifen, anstatt Primärquellen wie Verträge oder Finanzberichte auszuwerten.
Ursachen und Risiken: Ein Teufelskreis aus Effizienz und Qualitätsverlust
Der Trend zur Selbst-Kannibalisierung wird durch Kostendruck und den Wunsch nach Geschwindigkeit angetrieben. KI-generierter Output ist oft schneller und günstiger als menschliche Analyse. Dies führt zu einem Kaskadeneffekt, bei dem mit jedem Verarbeitungsschritt Substanz verloren geht. Die Hauptrisiken sind:
- Bias-Verstärkung: Bestehende Vorurteile oder Modellannahmen werden zirkulär verstärkt.
- Qualitätsverlust: Entscheidungen basieren auf scheinbar konsistenten, aber realitätsfernen Informationen.
- Scheinsicherheit: Die Daten erscheinen perfekt aufbereitet, obwohl sie wichtige Abweichungen und Risiken verschleiern.
- Unklare Herkunft: Werden KI-generierte Daten nicht gekennzeichnet, verschwimmt die Trennlinie zwischen Primärdaten und synthetischen Daten (Halluzinationen).
Strategien zur Risikominimierung: Governance und menschliche Kontrolle
Um die Risiken zu beherrschen, sind klare Leitplanken unerlässlich:
- Human-in-the-Loop: KI-Ergebnisse dürfen niemals blind übernommen werden. Fachexperten müssen die Resultate validieren und kontextualisieren.
- Strikte Daten-Governance: Es muss eine klare Trennung zwischen Primärdaten (Transaktionen, Verträge) und abgeleiteten, KI-generierten Daten geben.
- Kennzeichnungspflicht: Jeder Output sollte dokumentieren, ob er aus Primärquellen stammt, KI-unterstützt erstellt wurde oder vollständig KI-generiert ist.
- Diversifizierte Trainingsdaten: Originäre Quellen müssen der Kern jedes Trainingssets bleiben. KI-Daten dürfen nur ergänzen, niemals ersetzen.
Berechtigte Vorsicht oder Angst vor Neuem?
Im Private-Market-Kontext handelt es sich weniger um Angst vor Technologie, sondern um berechtigte Vorsicht. Die Daten sind hier knapp, heterogen und hochsensibel. Ein kleiner Fehler kann NAVs, Cashflow-Prognosen oder regulatorische Reports massiv verzerren. Die oft als „Black Box“ kritisierten Modelle stehen im Widerspruch zur geforderten Nachvollziehbarkeit für Investoren und Regulatoren. Die richtige Haltung ist daher weder blinde Euphorie noch strikte Blockade, sondern eine bewusste, kontextbezogene und streng kontrollierte Nutzung von KI.
Fazit: KI als Werkzeug, nicht als Orakel
KI ist im Private Markets Sektor zweifellos ein Effizienz-Booster. Doch ohne klare Governance, strenge Datenkontrolle und eine konsequente Kennzeichnungspflicht droht die Gefahr, dass sich KI-Systeme selbst kannibalisieren. Anstatt die Qualität zu steigern, könnten sie mittelfristig dazu führen, dass die Informationsbasis immer homogener, flacher und letztlich weniger belastbar wird. Private Markets, die auf knappen und sensiblen Daten basieren, laufen damit Gefahr, sich von der Realität zu entkoppeln – mit erheblichen Risiken für Investoren und Asset Manager.
Quellen
- ESMA / EBA: Konsultationspapiere zu KI im Finanzsektor
- Studien zur „Model Collapse“ / „AI Cannibalism“

